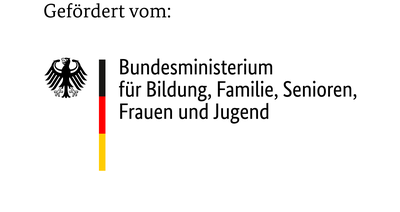Individualisierung und Adaptivität als Chance für guten Unterricht - Der Heterogenität in Schulen begegnen
Kinder lernen unterschiedlich und haben verschiedene Lernbedarfe. Individualisierung und Adaptivität im Unterricht bieten eine Chance, diese Bedarfe wahr- und ernst zu nehmen und Kinder individuell auf ihrem Weg zu begleiten. Was anfänglich Mut bedarf, zahlt sich aus - durch freiwerdende Zeitressourcen und Lernzuwachs der Kinder.
Diesen InfoTEXT als PDF downloaden.
Zitationsvorschlag: Wenzel, B., Dumont, H., Telle, S., Thurau, A., & Vogel, S. (2025). Individualisierung und Adaptivität als Chance für guten Unterricht: Der Heterogenität in Schulen begegnen. (InfoTEXT aus KONTEXT Grundschule, 3). DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation. https://doi.org/10.25657/02:33788
Worum geht es?
“Vergleiche nie ein Kind mit einem anderen, sondern immer nur mit sich selbst.”
(Johann Heinrich Pestalozzi)
Gerade im Grundschulbereich sieht man sich als Lehrkraft mit einer besonders heterogenen Lerngruppe konfrontiert. Jedes Kind einer Schulklasse bringt individuelle Lernvoraussetzungen, Erfahrungen und Bedürfnisse mit. Während einige bereits lesend zur Schule kommen oder über besonders viel lernrelevantes Vorwissen verfügen, benötigen andere in Lern- und/oder sozialen Entwicklungsbereichen etwas mehr Unterstützung. Wieder andere lernen vielleicht gerade erst die Landessprache neu. Es stellt sich also die Frage, wie es gelingen kann, den Unterricht so zu gestalten, dass individuelle Lernbedarfe der Schüler*innen berücksichtigt und adressiert werden. Dieser Beitrag soll Lehrkräften eine Hilfe sein, hierauf für sich eine Antwort zu finden und zu verstehen, wie der Unterricht individuell auf einzelne Kinder angepasst werden kann. Es werden Strategien aufgezeigt, um eine Gleichschrittigkeit des Unterrichts zu vermeiden und der Heterogenität der Klasse gerecht zu werden. So benötigen Kinder, die in bestimmten Lernbereichen mit besonderen Herausforderungen konfrontiert sind, mehr Zeit und Unterstützung durch die Lehrkraft. Andere sollten hingegen nicht gebremst werden. Um Über- und Unterforderung zu vermeiden, braucht es den Mut, als Lehrkraft die Gleichschrittigkeit aufzuheben und jedes Kind in seiner Individualität ernst zu nehmen. Nur so ist es möglich, die Botschaft zu vermitteln: “Du bist gut so, wie du bist und kannst schaffen, was die Schule von dir möchte.” Nur wenn Lehrkräfte das erreichen, bleibt die natürliche Lernfreude erhalten, die Kinder aus der Zeit vor der Grundschule mitbringen.
Was sagt die Forschung?
Es existieren eine Vielzahl von Konzepten und Begrifflichkeiten zum Umgang mit Heterogenität im Unterricht: Individualisierung, individuelle Förderung, Binnendifferenzierung, personalisiertes Lernen oder adaptiver Unterricht1. Allen ist jedoch ein Gedanke gemeinsam: es geht um die Anpassung des Unterrichts an individuelle Lernbedarfe aller Schüler*innen.
Sowohl Makro- als auch Mikroanpassungen des Unterrichts müssen vorgenommen und miteinander verzahnt werden. Bei Makroanpassungen wird das Lernangebot langfristig geplant, etwa durch Variation von Inhalten oder Schwierigkeitsgraden2,3. Mikroanpassungen stellen situative Anpassungen im Unterricht dar, wobei die Unterstützung durch die Lehrkraft eine entscheidende Rolle spielt2,3.
Besonders Schüler*innen mit wenig Vorwissen und geringen Selbstregulationsstrategien profitieren von intensiver Unterstützung und Steuerung durch die Lehrkraft1,4. Für Schüler*innen mit hohem Vorwissen kann ein hoher Unterstützungs- und Steuerungsgrad hingegen eher hinderlich sein1,4. Dieses Phänomen wird als Expertise Reversal Effect (oder Umkehreffekt) bezeichnet: Je nach Vorwissen dreht sich der Effekt bestimmter Instruktionen um4. Entsprechend flexibel muss auf Lernstände reagiert werden, um den Umkehreffekt zu vermeiden.
Zentral sind dabei formelle und informelle lernbegleitende Diagnostik sowie standardisierte Lernstandserhebungen, z. B. in Form von Fragen, Aufgabenbesprechungen oder standardisierten Instrumenten3. Sie bieten die Basis für passgenaue Lernangebote. Ein weiteres Kernelement des individualisierten Unterrichts ist die Förderung des selbstregulierten Lernens. Durch hohe selbstregulative Kompetenzen der Schüler*innen können Zeitressourcen für die Lehrkräfte geschaffen werden, etwa zur Unterstützung anderer3. Die Vermittlung von kognitiven (z. B. Concept Map) und metakognitiven (z. B. Lernzielformulierung) Strategien ist dabei förderlich3.
Wichtig für einen Unterricht, der die individuellen Lernbedarfe berücksichtigt, ist, dass Lernwege der Kinder nicht vereinzelt werden. Vielmehr muss das Zusammenspiel von Einzelarbeits- und kooperativen Phasen durch die Lehrkraft orchestriert werden1. Auch in individuellen Phasen kann kooperiert werden, etwa durch Peer-Tutoring. In Gruppenarbeiten ermöglichen z. B. differenzierte Materialien, dass individuelle Lernstände berücksichtigt werden.
Heterogenität im Fokus
Um der heterogenen Schüler*innenschaft zügig passgenaue Aufgaben bereitzustellen, können adaptive Lerntechnologien helfen3. Dabei ist es zentral, den Einsatz von Lerntechnologien mit dem Handeln der Lehrkraft zu verzahnen5. Hybride Systeme mit Eingriffsmöglichkeiten durch Lehrkräfte bieten hier neue Potenziale.
Digitales zum Thema
Erfahre in diesem animierten Video, wie Unterricht so (um-) gestaltet werden kann, dass er die individuellen Bedürfnisse von Schüler*innen berücksichtigt.
Was bedeutet das für mich als Lehrkraft und was kann ich tun?
Das Aufbrechen der klassischen Unterrichtsstruktur ist DIE Voraussetzung für individualisierten Unterricht. Das bedeutet nicht, dass jedes Kind machen kann, was es will. Es ist die Aufgabe der Lehrkraft, eine sinnvolle Struktur aufzubauen, in der sich die Kinder zurechtfinden. Mit Struktur sind hier Arbeitspläne, die räumliche Organisation, die Auswahl passender Materialien sowie Abläufe und Rituale gemeint. Die konsequente Aufrechterhaltung und Evaluation der neuen Struktur sind wichtige Aspekte für das Gelingen des individualisierten Unterrichts.
Eine gute Struktur ermöglicht der Lehrkraft, einen umfassenden Überblick über die Lernstände der Kinder zu behalten und zu entscheiden: “Wen kann ich laufen lassen und wer benötigt noch Unterstützung?” An dieser Stelle wirkt der Expertise Reversal Effect: Die Tatsache, dass manche Kinder wenig Unterstützung beim Lernen und in der Organisation brauchen, schafft für die Lehrkraft Freiräume und zusätzliche Zeitressourcen, sich um Kinder zu kümmern, die mehr Unterstützung benötigen.
Viele Verlage haben sich mittlerweile darauf eingestellt, dass in Schule heutzutage eine große Heterogenität anzutreffen ist. Es gibt eine Vielzahl an Aufgabensammlungen, die im individualisierten Unterricht eingesetzt werden können. Wichtig dabei ist, dass die Lehrkraft sich für passende Materialien entscheidet, damit sie auf die Bedarfe jedes Kindes flexibel reagieren kann. Damit Kinder ernstgenommen werden und ihre Motivation erhalten bleibt, ist es wichtig, sie an der Planung ihres Lernprozesses zu beteiligen. Mit der Zeit lernen sie, gemeinsam mit der Lehrkraft ihre Ziele zu formulieren und zu reflektieren. Hilfreich dafür ist es, Lernstoff und Lernwege zu visualisieren.
Um zu wissen, wo jedes Kind in seinem Lernprozess steht, spielt die Diagnostik eine wichtige Rolle. Da sich die Kinder im individualisierten Unterricht an sehr unterschiedlichen Stellen befinden, findet die Diagnostik und Lernstandüberprüfung nicht für alle Kinder zum selben Zeitpunkt statt. So lässt sich sicherstellen, dass jedes Kind die Zeit zum Üben bekommt, die es benötigt. In der Praxis hat es sich bewährt, zu Beginn eines neuen Themas mit einer Lernstandserhebung (Vortest) zu arbeiten. Die Lehrkraft sieht so, was ein Kind schon kann und an welchen Bereichen es noch arbeiten muss, um das neue Thema zu verstehen. Eine Lernzielkontrolle zum Abschluss gibt Auskunft darüber, ob das Kind den Lernstoff verstanden hat. Zusätzlich ist es sinnvoll, allgemein bekannte Diagnostikverfahren wie z. B. die Hamburger Schreibprobe6 durchzuführen.
Bedenkenträger*innen befürchten im individualisierten Unterricht die Vereinzelung der Kinder und stellen sich die Frage, wie man dem entgegenwirken kann. Die Praxis zeigt viele verschiedene Bereiche, in denen die Kinder während eines Schultages gemeinsam lernen, z. B. bei kooperativen Aufgaben innerhalb der Arbeitspläne, in gemeinsamen Unterrichtsgesprächen (Satz des Tages, Schätzglas, ...) und im Klassenrat.
Zunächst ist die Umstellung des Unterrichts mit viel Arbeit verbunden, denn es ist eine gewisse Herausforderung, die oben beschriebene Struktur zu erarbeiten. Deshalb ist es ratsam, Gleichgesinnte zu suchen und sich mit ihnen zusammenzutun, um best practices, bewährte Methoden, Arbeitsblätter etc. auszutauschen. Diese anfängliche Mehrarbeit zahlt sich aber nach kürzester Zeit aus, weil der Alltag dann nicht mehr davon geprägt ist, mit spontanen Reaktionen und Aufgaben die Über- und Unterforderung der Kinder auffangen zu müssen. Außerdem stellt sich sowohl bei den Lehrkräften als auch bei den Kindern eine entspannte Routine ein, wenn die Struktur etabliert und verinnerlicht ist. Einmal erarbeitete Materialien und Pläne sind für alle Kinder einsetzbar – oftmals nur zu unterschiedlichen Zeitpunkten und nicht für alle zur selben Zeit. Durch den Effekt, dass schnell lernende Kinder weniger Unterstützung benötigen, werden für Kinder, die mehr Unterstützung benötigen, zusätzliche Zeitfenster für Erklärungen etc. frei. Auch dies stellt eine spürbare Entlastung im Alltag dar.
Von ausgezeichneten Schulen lernen – Hospitationsprogramm
Fazit
Individualisierter Unterricht bedarf einer neuen Struktur. Nach anfänglicher Mehrarbeit entsteht ein entspanntes Lernumfeld, in dem alle Kinder ihr individuelles Potential ausschöpfen können. Lernbegleitende Diagnostik, die Förderung der Selbstregulation sowie die Koordination von Einzel- und Gemeinschaftsphasen stellen dabei Schlüsselelemente dar.
Autor*innen
Dieser InfoTEXT ist eine Wissenssammlung, der die Expertisen aus Forschung und Praxis vereint, indem er in mehreren Schritten von Grundschullehrkräften und Bildungswissenschaftler*innen kokonstruktiv ausgehandelt wurde.


Literatur
1. Dumont, H. (2018). Neuer Schlauch für alten Wein? Eine konzeptuelle Betrachtung von
individueller Förderung im Unterricht. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 22, 249-277.
https://doi.org/10.1007/s11618-018-0840-0
2. Corno, L. (2008). On teaching adaptively. Educational Psychologist, 43(3), 161-173.
https://doi.org/10.1080/00461520802178466
3. Dumont, H., Hofer, S., & Reinhold, F. (2025). Schülermerkmale und Adaptiver Unterricht. In
M. Syring, T. Bohl, A. Gröschner, & A. Scheunpflug (Hrsg.), Studienbuch
Bildungswissenschaften 2: Unterricht und Schule gestalten (S. 171-189). utb GmbH.
https://doi.org/10.36198/9783838562193
4. Tetzlaff, L., Simonsmeier, B., Peters, T., & Brod, G. (2025). A cornerstone of adaptivity – A
meta-analysis of the expertise reversal effect. Learning and Instruction, 98.
https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2025.102142
5. Scheiter, K. (2021). Lernen und Lehren mit digitalen Medien: Eine Standortbestimmung.
Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 24, 1039–1060. https://doi.org/10.1007/s11618-021-
01047-y
6. May, P., Malitzky, V., & Vielhuf, U. (2018). Hamburger Schreib-Probe 1–10. vpm